Psychoanalytikerinnen in Russland
Geschichte
|
Tatjana Aleinikowa Lou Andreas-Salomé (Deutschland) Esther Aptekmann (Schweiz) Rosa Awerbuch Lenina Bondarenko (Osteuropa) Fanny Chalewsky (Schweiz) Sophie Erismann (Schweiz) Lia Geschelina |
Tatjana Ignatjewna Goldowskaja Ekaterina Goltz Scheina Grebelskaja (Schweiz) Natalia Iljina Sophia Liosner-Kannabich Fanja Lowtzky (Israel) Anna Mänchen-Helfen (Österreich) Sara Neiditsch |
Militsa Netschkina Mira Oberholzer (Schweiz) Tatjana Pushkaryeva (Osteuropa) Angela Rohr Tatiana Rosenthal Vera Schmidt Anna Smeliansky (Israel) Sabina Spielrein |
Tatjana Aleinikowa (1931-2020)

Tatjana Weniaminowna Aleinikowa wurde in Rostow am Don geboren. Nach ihrem Abschluss in Human- und Tierphysiologie an der Fakultät für Biologie und Bodenkunde der Rostower Staatlichen Universität [Ростовском госуниверситете (РГУ)] im Jahr 1954 lehrte sie bis 1960 Normale Physiologie an der Medizinischen Fakultät Rostow. 1958 promovierte sie über die Wiederherstellung des kortikalen visuellen Systems nach dessen Ausfall im frühen Lebensalter.
Von 1960 an war Tatjana Aleinikowa an der Rostower Staatlichen Universität als Psychophysiologin und Neurophysiologin tätig. Sie war Leiterin des Labors zur Erforschung visueller Informationsverarbeitung und lehrte am Department für Human- und Tierphysiologie, zunächst als Assistentin, dann als Assistenzprofessorin und ab 1984 als ordentliche Professorin, nachdem sie sich 1983 über die visuelle Informationsverarbeitung des Froschs habilitiert hatte. Seit 1995 war sie Mitglied der New Yorker Akademie der Wissenschaften.
1960 hatte sie damit begonnen, an der Rostower Universität auch Einführungen in die Psychoanalyse anzubieten. Solange Freuds Lehre in Russland offiziell nicht zugelassen war, vermittelte sie die psychoanalytischen Inhalte unter dem Deckmantel der Physiologie der höheren Nerventätigkeit, ab 1985 dann in einem Grundkurs Psychoanalyse für Philosophen, Biologen und Psychologen. Seit 1996 praktizierte Tatjana Aleinikowa als psychoanalytisch orientierte Psychotherapeutin. 1997 wurde sie Mitglied der Rostower Psychoanalytischen Vereinigung, deren Ehrenpräsidentin sie ab 2002 war, und 2004 Mitglied der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung. Seit 2007 gehörte sie auch dem Europäischen Psychotherapieverband an.
Aus Aleinikowas Feder stammen ca. 300 wissenschaftliche Publikationen über Themen aus den Bereichen Neurophysiologie, Psychophysiologie, Neurokybernetik, Psychoanalyse und "Psychokorrektur". Auf der Grundlage von Neurophysiologie, Psychophysiologie und Psychoanalyse entwickelte sie ihren eigenen interdisziplinären psychotherapeutischen Ansatz und wurde zur Begründerin der Rostower psychoanalytischen Schule. Dabei seien nicht nur die Psychodynamik (im Freudschen Sinn) des Analysanden und sein soziales Umfeld zu berücksichtigen, sondern auch seine neurophysiologischen Funktionen und sein psychophysiologischer Persönlichkeitstypus.
Tatjana Aleinikowa war mit dem russischen Biologen Gennadij Iwannikow (*1930) verheiratet, die Ehe dauerte nur einige Jahre. Sie hatte einen Sohn, Alexander Gennadjewitsch Iwannikow (*1955), der als Dichter bekannt wurde, und eine Tochter, Anna Juriewna Aleinikowa (*1964). (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN (Auswahl)
- О функциональном и анатомическом восстановлении коркового отдела зрительного анализатора после его удаления в раннем возрасте. Phil. Diss. Rostow 1958
- Переработка информации о признаках сигнала в зрительной системе лягушки. Dr. habil. Rostow 1983
- Физиология центральной нервной системы [Physiologie des zentralen Nervensystems]. Rostow am Don 1995; 2006
- Психоанализ [Psychoanalyse]. Rostow am Don 2000
- Введение в классический психоанализ. Зигмунда фрейда (1856-1939) [Einführung in die klassische Psychoanalyse: Sigmund Freud (1856-1939)]. Via Regina 2003
- Возрастная психофизиология [Psychophysiologie des Alters]. Rostow am Don 2002
- LITERATUR + LINKS
- Rostower Psychoanalytische Vereinigung (13.8.2020)
- SFedU (Southern Federal University), 1.7.2020 (13.8.2020 - inzwischen gelöscht)
- Via Regina - Psychologisches Zentrum Rostow am Don (13.8.2020 - gekürzte Fassung)
- Wikipedia: Tatjana Aleinikowa; Alexander Gennadjewitsch Iwannikow (13.8.2020)
- FOTO: Wikipedia (13.8.2020)
Rosa Awerbuch (1883-1940)

Rosa Abramowna Awerbuch (auch: Roza Averbukh) wurde in Kasan in der russischen Republik Tatarstan geboren. Ihre jüngere Schwester Rebekka Abramowna Awerbuch war eine bekannte Historikerin. Rosa Awerbuch besuchte bis 1899 das Mädchengymnasium in Kasan und studierte von 1901 bis 1909 Medizin in Bern und Zürich, wo sie 1909 promovierte. Möglichweise kam sie hier mit dem Kreis um C.G. Jung in Kontakt und lernte die Psychoanalyse kennen. Sie kehrte nach Kasan zurück und schloss 1911 ihr Studium an der medizinischen Fakultät der Kasaner Universität ab. Von 1912 bis 1917 engagierte sie sich in der gewählten regionalen Verwaltung, die u. a. für den Aufbau des Gesundheitswesens zuständig war. 1917 nahm sie ihre Tätigkeit an der Kasaner Universitätsklinik auf und lehrte von 1921 bis 1923 am Klinischen Institut Kasan.
1921 erschien ihre russische Übersetzung von Sigmund Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse. 1922 wurde sie Mitglied der von Alexander Lurija im gleichen Jahr gegründeten Kasaner Psychoanalytischen Vereinigung. Dort referierte sie im September 1922 über die psychosexuellen Motive eines Intellektuellen, der sich der Räteregierung widersetzt hatte, als diese zur Bekämpfung der Hungersnot in Russland Kirchenvermögen konfiszierte. Ihr Beitrag wurde von ihrem Kollegen Nikolaj Ossipow heftig kritisiert, der darin eine Verletzung des Gebots politischer Abstinenz sah. Rosa Awerbuch gehörte wie Lurija zu einer Gruppe Kasaner Analytiker:innen, die für die Vereinbarkeit von Psychoanalyse und Marxismus eintraten.
1923 zog sie nach Moskau und trat der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung bei, deren Mitglied sie bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1930 war. Sie war Mitarbeiterin am Staatlichen Institut für Psychoanalyse, wo sie ein Seminar zur Psychoanalyse religiöser Systeme abhielt, und Assistenzärztin in dem von Mosche Wulff geleiteten psychoanalytischen Ambulatorium. Sie war auch Mitarbeiterin in Vera Schmidts psychoanalytischem Kinderheim-Laboratorium. Von 1925 an war sie außerdem am Institut für experimentelle Psychologie tätig und gehörte zum Kreis um den sowjetischen Psychologen Lew Wygotski. Einer ihrer Schwerpunkte war die psychoanalytische Deutung des Werks von Wassili Rosanow, dessen philosophische Studien, insbesondere seine Schriften über Religion und Sexualität, ihrer Ansicht nach den Theorien Sigmund Freuds sehr nahe kommen. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN + VORTRÄGE (Auswahl)
- Über die Häufigkeit der Harnsteine in der Schweiz. Med. Diss. Zürich 1909/10
- Psychoanalyse eines Gerichtsfalles. Zur Konfiskation der Kirchenschätze in Rußland (Vortrag, 7.9.1922). IZP 8 (4), 1922, 523-524
- Die psychosexuelle Theorie von W. Rosanow (Vortrag, 31.5.1923). IZP 9 (2), 1923, 239
- Über die Psychoanalyse religiöser Systeme (Seminar 1/1924). IZP 10 (3), 1924, 352
- Über einen Fall von Homosexualität (Vortrag, 12.11.1925). IZP 12 (2), 1926, 228
- Das Unbewußte in William James' „The varieties of religious experience“ (Vortrag, 17.11.1927). IZP 14 (2), 1928, 295
- LITERATUR + LINKS
- Etkind, Alexander: Eros des Unmöglichen. Die Geschichte der Psychoanalyse in Rußland. Leipzig 1996
- Freud, Sigmund, und Nikolaj J. Ossipow: Briefwechsel 1921-1929. Frankfurt/M. 2009
- Internationales Institut für Familienforschung + Nowodewitschi-Friedhof (18.12.2015)
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002
- Larny, Marty: Beitrag vom 15.6.2013 auf Vive Liberta (29.10.2018 - inzwischen gelöscht)
- Matrikeledition der Universität Zürich (6.6.2019)
- Ovcharenko, Viktor Iwanowitsch: Russische Psychoanalytiker: Авербух Роза Абрамовна. 2000, 9 (10.11.2021)
- Проект «Весь Фрейд» {Freud-Projekt) (21.12.2023)
- Rückriem, Georg (Hg.): Lev Lemënovič Vygotskij. Briefe / Letters 1924-1934. Bd. 21. Berlin 2009
- Yasnitsky, Anton: Vygotsky Circle as a Personal Network of Scholars. Restoring Connections Between People and Ideas. Integrative Psychological and Behavioral Science 45, 2011, 422-457 (15.12.2015)
- Wikipedia: Awerbuch, Rebekka Abramowna; Kinderheim-Laboratorium (21.12.2023)
- FOTO: Nowodewitschi-Friedhof (12.9.2024)
Lia Geschelina (1892-1972?)
Die russische Ärztin Lia Solomonowna Geschelina gehörte in der ersten Hälfte der 1920er Jahre zu den Mitarbeiter:innen des Staatlichen Instituts für Psychoanalyse und des psychoanalytischen Kinderheim-Laboratoriums Vera Schmidts in Moskau. Sie war ab 1924 Mitglied der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung [Русское психоаналитическое общество] bis diese 1930 im Zuge der stalinistischen Kulturrevolution aufgelöst wurde.
In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre arbeitete Lia Geschelina als Pädologin in Moskau. Aus dieser Zeit datieren ihre in der Zeitschrift Pedologija veröffentlichte Artikel über das moderne Vorschulkind. Darin beschrieb sie anhand einer 1925/1926 von ihr durchgeführten Untersuchung von Moskauer Kindergartenkindern den Einfluss sozialer und ökonomischer Bedingungen auf die körperliche Entwicklung von Kindern aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien. In den 1930er Jahren gehörte sie wie Vera Schmidt und Rosa Awerbuch dem Forschungsteam des sowjetischen Entwicklungspsychologen Lew Wygotski an, des Begründers der Kulturhistorische Schule. Geschelinas Aufzeichnungen von Wygotskis Untersuchungsprotokollen über behinderte Kinder sind nach ihrem Tod verloren gegangen.
Bekannt wurde besonders eine experimentelle Studie zur Struktur und Entwicklung der Wahrnehmungsfunktion, die Lia Geschelina als Mitarbeiterin Wygotskis um 1930 durchführte (Wygotski 1930). Sie verglich normale Kinder mit taubstummen oder geistig zurückgebliebenen Kindern und konnte nachweisen, dass Sprache in einem frühen Alter die Entwicklung von anschaulichem Denken und visueller Wahrnehmung beeinflusst und verändert. 1949 verfasste sie gemeinsam mit Roman Y. Lyusternik eine Studie über die Anwendung von Schlaftherapie bei schizophrenen Patienten. In der Sowjetunion zählte sie zu den Psychiater:innen, die sich während der 1960er Jahre für die psychotherapeutische Behandlung von Schizophrenen einsetzten. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN (Auswahl)
- Среда и социально-биологическая характеристика современного дошкольника [Milieu und soziobiologische Eigenschaften des modernen Vorschulkindes]. Pedologija Nr. 1, 1928, 113-136
- Социально-биологическая характеристика современного дошкольника [Soziobiologische Eigenschaften des modernen Vorschulkindes]. Pedologija Nr. 1-2, 1929, 139-144
- Влияние среды и наследственности на рост ребенка [Der Einfluss von Umwelt und Vererbung auf das Wachstum eines Kindes]. Pedologija Nr. 4, 1930, 451-462
- (und Roman Y. Lyusternik) Катамнезы больных шизофреников, леченных длительным сном. Moskau 1949
- LITERATUR + LINKS
- Etkind, Alexander: Eros des Unmöglichen. Die Geschichte der Psychoanalyse in Rußland. Leipzig 1996
- Gurevich, Pavel Semenovich (Hg.): Психоанализ. Популярная энциклопедия [Psychoanalyse. Eine populäre Enzyklopedie]. Moskau 1998
- Kalmykowa, Inga Yurievna: Краткая история и современное состояние клинической психотерапии шизофрении [Eine kurze Geschichte und der aktuelle Stand der klinischen Psychotherapie bei Schizophrenie]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii 4 (15), 2012 (6.12.2012)
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Tübingen 2002
- MedicalPlanet (5.12.2012)
- Уральский, Марк: Небесный залог. Портрет художника в стиле коллажа [Uralski, Mark: Himmlische Bürgschaft. Porträt einer Künstlerin im Collage-Stil]. Moskau 2013 (22.12.2015)!-->
- The Essential Vygotsky. Hg. von R. W. Rieber und D. K. Robinson. New York 2004
- Wikipedia: Детский дом-лаборатория «Международная солидарность» [Kinderheim-Laboratorium «Internationale Solidarität»] (21.12.2023)
- Выготский Л.С.: Проблема высших интеллектуальных функций в системе психотехнического исследования [Wygotski, L. S.: Das Problem höherer intellektueller Funktionen im System der psychotechnischen Forschung]. Психотехника и психофизиология труда III (5), 1930, 373-384 + Культурно-историческая психология 3 (3), 2007,105–111 (13.9.2024)
- Yasnitsky, Anton: Vygotsky Circle as a personal network of scholars. Restoring connections between people and ideas. Integrative Psychological and Behavioral Science 45, 2011, 422-457 (4.12.2012)
Tatjana Ignatjewna Goldowskaja (1898-1978)
Die russische Psychiaterin Tatjana Ignatjewna Goldowskaja war von 1927 bis 1930 außerordentliches Mitglied der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung (RPV) [Русского психоаналитического общества]. Die 1922 von Iwan Jermakow und Mosche Wulff gegründete RPV wurde 1930 offiziell aufgelöst. T. I. Goldowskaja war in den 1920er/1930er Jahren Assistenzärztin am Institut für neuropsychiatrische Prophylaxe [Институт невропсихиатрической профилактики] in Moskau, das von dem führenden sowjetischen Psychiater Lew Markowitsch Rosenstein geleitet wurde. Das Institut, vormals eine Poliklinik, bestand aus einer Ambulanz, mehreren Laboratorien und einer Abteilung für Psychohygiene, die Untersuchungen in Fabriken und Betrieben durchführte.
Als Mitarbeiterin Lew Rosensteins war Goldowskaja an der Entwicklung der theoretischen Grundlagen für eine psychohygienische Neuausrichtung der sowjetischen Psychiatrie beteiligt. Ihr Ansatz, bestehend aus einer Verbindung medizinischer Prävention mit Psychohygiene und Pädologie, der Reflexologie Bechterews und der Psychoanalyse Freuds, sollte nicht nur für psychiatrische Aufgaben, sondern auch im Bereich der Erziehung und Bildung angewendet werden. Psychohygiene und Pädologie wurden 1936 allerdings vom ZK der KPdSU verurteilt - im gleichen Jahr verbot Stalin die Lehre Freuds.
Seit den 1940er Jahren war Tatjana Ignatjewna Goldowskaja als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moskauer Staatlichen Forschungsinstituts für Psychiatrie tätig. 1964 habilitierte sie sich an der Staatlichen Medizinischen Pawlow-Universität Rjasan. Sie verfasste zahlreiche Arbeiten zu klinisch-sozialen und organisatorischen Fragen der psychiatrischen Versorgung in der Sowjetunion.
Möglicherweise war sie mit E. D. Goldowsky verwandt, Mitglied einer psychoanalytischen Gruppe in Kiew, der ebenfalls zwischen 1927 und 1930 außerordentliches Mitglied der RPV war. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN (Auswahl)
- Л.М. Розенштейн и клинико-профилактика-психогигиеническое направление в психиатрии [L. M. Rosenstein und die klinisch-präventiv-psychohygienische Richtung in der Psychiatrie]. Советская невропатология, психиатрия, психогигиена [Sowjetische Neuropathologie, Psychiatrie und Psychohygiene] Nr. 5, 1934 + in Ю.А. Александровский (Hg.): Пограничная психиатрия [Borderline-Psychiatrie]. Moskau 2006
- Психогигиена в высшем учебном заведении [Psychohygiene in der Hochschule]. Советская невропатология, психиатрия, психогигиена [Sowjetische Neuropathologie, Psychiatrie und Psychohygiene] Nr. 10, 1934
- Пути и методы изучения нервно-психической заболеваемости (Клинико-стат. исследование) [Wege und Methoden zur Untersuchung der neuro-psychischen Morbidität (Klinisch-statistische Untersuchung)]. Diss. Dr. sc. med. Moskau 1964
- (und S. I. Goldenberg) Die sozial-sittlichen Lebensbedingungen der Epileptiker im Zusammenhang mit den klinischen Krankheitserscheinungen. Zschr gesamte Neurol Psychiatr 121 (1), 1929, 780-791
- (und С. И. Гольденберг) Проблемы неврастении и неврозов [(und S. I. Goldenberg) Probleme der Neurasthenie und der Neurosen] (1935). In Ю.А. Александровский (Hg.): Пограничная психиатрия [Borderline-Psychiatrie]. Moskau 2006 + РЛС
- (und Б.Р. Гурвич) Советская медицина в борьбе за здоровые нервы [(und B. R. Gurvich) Die sowjetische Medizin im Kampf für gesunde Nerven]. Труды I Всесоюзного совещания по психиатрии и неврологии и государственного неврологического диспансера [Tagungsband des I. Allunionskongress der Neurologen und Psychiater und des Staatlichen Neurologischen Ambulatoriums]. Moskau 1926, 54-57 + РЛС
- LITERATUR + LINKS
- Александровский, Юрий Анатольевич (Hg.): Пограничная психиатрия (Краткие биографические сведения об авторах) [Aleksandrowski, Juri Anatoljewitsch (Hg.): Borderline-Psychiatrie]. Moskau 2006 + РЛС (23.5.2025)
- Eracar, Nevin: Unearthing the hidden history of autism and a devoted female scientist: Grunya Efimovna Sukhareva. Diyalektik ve Toplum 3 (1), 2020, 37-42 (23.5.2025)
- IZP 22 (1), 1936, 133
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002
- Савенко, Ю.С.: Лев Маркович Розенштейн (1884-1934) [Savenko, J. S.: Lew Markowitsch Rosenstein (1884-1934)]. Независимая психиатрическая ассоциация России [Journal of the Independent Russian Society for Psychiatry] 3, 2004 (23.5.2025)
Ekaterina Goltz (1889/1892-1944)

Ekaterina Pawlowna Goltz wurde in Moskau als Tochter eines Ingenieurs geboren. Ihr Bruder Georgi Pawlowitsch Goltz war ein bekannter sowjetischer Architekt. Nach Abschluss ihres Medizinstudiums praktizierte sie als Fachärztin für Physiologie. 1927 wurde sie außerordentliches, 1930 ordentliches Mitglied der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung (RPV). Ende 1927 hielt sie dort einen Vortrag mit dem Titel "Beobachtungen während des Erdbebens in der Krim". Darin beschrieb sie die psychischen Reaktionen von Überlebenden des Erdbebens, wie regressives Verhalten, Störungen der Zeitwahrnehmung und eine Herabsetzung der Über-Ich-Kontrolle. Bei einigen Personen, die überhaupt nicht auf die Gefahr reagierten, schloss sie auf einen unbewussten Todeswunsch.
Während der stalinistischen Kulturrevolution wurde die RPV 1930 aufgelöst. Ekaterina Goltz, die bei der Familie ihres Bruders in der Moskau lebte, arbeitete in den 1930er Jahren als Physiologin am Allunions-Institut für experimentelle Medizin in Moskau.
1939 wurde sie verhaftet, vermutlich weil sie zum Freundeskreis um Jewgenia Khayutina gehörte, der Ehefrau von Nikolai Jeschow, Chef der sowjetischen Geheimpolizei NKWD, der selbst Opfer der stalinistischen Säuberungen wurde. Ekaterina Goltz wurde 1940 wegen "konterrevolutionärer Agitation und antisowjetischer Verbindungen" zu acht Jahren Arbeitslager verurteilt. Während dieser Zeit arbeitete sie als Ärztin im Lagerkrankenhaus von Sevzheldorlag und referierte 1941 auf einer Pellagra-Konferenz in Knyazhpogost über "Avitaminose des Auges". Im April 1944 wurde sie aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig entlassen. Auf dem Weg nach Hause starb sie jedoch plötzlich, vermutlich an einem Schlaganfall. (Artikelanfang)
- VORTRÄGE (Auswahl)
- Наблюдения, сделанные во время землетрясения в Крыму [Beobachtungen während des Erdbebens auf der Krim] (Vortrag, 3.11.1927). IZP 14 (2), 1928, 294
- Авитаминное поражение глаз [Avitaminose des Auges]. Vortrag auf einer Konferenz über Pellagra in Knyazhpogost, 5.12.1941
- LITERATUR + LINKS
- Открытый общественный архив по истории советского террора, Гулага и сопротивления режиму [Öffentliches Archiv zur Geschichte des sowjetischen Terrors, des Gulag und des Widerstands gegen das Regime] (21.12.2023)
- Goltz, Nika: Interview, 17.11.2011 (25.5.2025)
- IZP 13 (1), 1927, 137 + IZP 16 (3/4), 1930, 557
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002
- Wikipedia: Georgi P. Goltz; Jewgenia Salomonowna Khayutina; Nikolai Iwanowitsch Jeschow (15.8.2020)
- FOTO: Открытый общественный архив по истории советского террора (21.12.2023)
Natalia Iljina geb. Wokatsch (1882-1963)

Natalia Nikolajewna Wokatsch-Iljina wurde in eine Adelsfamilie in Moskau geboren als Tochter des Juristen Nikolai Antonowitsch Wokatsch und seiner Frau Maria Andrejewna Muromtsewa. Natalia Wokatsch studierte Literatur an den von Wladimir Guerrier eingerichteten Moskauer Höheren Kurse für Frauen, bevor sie 1906 den ebenfalls aus einer aristokratischen Familie stammenden russischen Philosophen Iwan Alexandrowitsch Iljin (1883-1954) heiratete.
Iwan Iljin war bei Hanns Sachs in Analyse und 1914 für ca. sechs Wochen bei Sigmund Freud in Wien. Auch Natalia Iljina-Wokatsch lernte während dieses Wien-Aufenthalts Freud kennen. Ob sie auch eine Analyse unternommen hat, ist nicht bekannt. 1922 gehörte sie jedenfalls wie ihr Mann in Moskau zu den Gründungsmitgliedern der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung.
Im gleichen Jahr wurde Iwan Iljin wegen antikommunistischer Betätigung zur Verbannung verurteilt. Natalia Iljina und ihr Mann zählten nach der Revolution von 1917 zu den Gegnern der Bolschewiki und wurden 1922 zusammen mit anderen Wissenschaftlern, Philosophen und Schriftstellern auf einem der "Philosophenschiffe" ins Exil geschickt. Sie ließen sich in Berlin nieder, wo Iwan Iljin am Russischen Wissenschaftsinstitut Rechtsphilosophie lehrte. Trotz seiner Sympathie für den Faschismus erhielt Iljin nach Hitlers Machtergreifung Berufsverbot. Die Iljins emigrierten 1938 in die Schweiz und lebten bis an ihr Lebensende in Zollikon.
Natalia Iljina verfasste philosophische und historische Studien und übersetzte gemeinsam mit ihrem Mann Bücher und Aufsätze ins Russische. Als ihr wichtigstes Werk gilt Izgnanie Normannov [Die Vertreibung der Normannen], worin sie die sog. Normannentheorie eines skandinavischen Ursprungs Russlands als russophobe Geschichtsklitterung kritisierte und die Hypothese ostslawischer Wurzeln der Rus vertrat. Mit dieser "antinormannistischen" Position befand sie sich im Einklang mit der sowjetischen Geschichtsschreibung. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN (Auswahl)
- Одиночество и общение [Einsamkeit und Kommunikation] (1916). In Iwan A. Iljin: Философия как духовное делание [Philosophie als geistige Tätigkeit]. Moskau 2013
- Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки [Die Vertreibung der Normannen. [Eine weitere Aufgabe der russischen Geschichtswissenschaft]. Paris 1955; St. Petersburg 2010 + История государства (2.6.2025)
- LITERATUR + LINKS
- Abraham, Karl, und Hanns Sachs: Brief vom 3. Dezember 1922, Berlin. Die Rundbriefe des "Geheimen Komitees", Bd 3: 1922. Hg. von G. Wittenberger und C. Tögel. Tübingen 2003, 237-243
- IZP 8 (2), 1922, 236
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002
- Nastenko, I. A.: Il'ina Nataliya Nikolayevna. Академия Тринитаризма (5.12.2016)
- Schmid, Ulrich: Eurasien oder Skandoslavien? Osteuropa 61 (2-3), 2011, 327-345
- Schoch, Jürg: "Ich möchte mit allem dem geliebten Schweizervolk dienen". Iwan Iljin, Wladimir Putins "geistiger Vater", lebte, schrieb und publizierte 16 Jahre lang in der Schweiz. Tagesanzeiger, 29.12.2014 (5.12.2016)
- Tsygankov, Daniel: Beruf, Verbannung, Schicksal: Iwan Iljin und Deutschland. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 87 (1), 2001, 44-60
- Wikipedia: Natalia Nikolajewna Iljina; Iwan Alexandrowitsch Iljin; Normannentheorie (4.6.2025)
- FOTO: Академия Тринитаризма (5.12.2016)
Sophia Liosner-Kannabich (1876-1968)
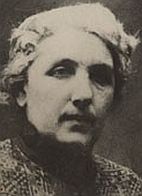
Die in Witebsk, Belarus, geborene Sophia Abramowna Liosner zählt zu den ersten Psychiaterinnen in Russland. 1894 begann sie ein naturwissenschaftliches Studium an der Sorbonne in Paris, wechselte dann aber nach Montpellier an die medizinische Fakultät, wo sie 1903 über die Verwendung von Schutzmasken bei Operationen promovierte.
Ein Stellenangebot in Algerien lehnte sie ab und kehrte stattdessen nach Russland zurück. In diese Zeit fiel die Ehe mit ihrem ersten Mann, einem damals bekannten Psychiater. Sophia Liosner arbeitete als Landärztin im Zwenigoroder Bezirk und legte dann, nachdem sie sich in St. Petersburg weitergebildet hatte, 1907 die Prüfung zur Erlangung des Arzttitels ab. Danach arbeitete sie in der privaten psychiatrischen Juri Loewenstein-Klinik [Лечебница Юрия Левенштейна] und nahm 1911 am Ersten Kongress der Russischen Gesellschaft der Psychiater und Nervenärzte teil.
1917 erwarb Sophia Liosner in Pokrowskoje-Streschnewo nordwestlich von Moskau ein Herrenhaus und richtete dort ein privates psychiatrisches Sanatorium ein. Zwei Jahre später wurde das Streschnewo-Sanatorium vom Moskauer Sowjet der Arbeiter- und Rotarmistendeputierten kommunalisiert. Auch ihr zweiter Ehemann, der Psychiater und Psychoanalytiker Juri Wladimirowitsch Kannabich (1872-1939), praktizierte hier von 1921 bis 1938, weshalb die psychiatrische Klinik, bekannt als ПКБ №12, nach ihm benannt wurde.
Juri Kannabich war 1922 Mitgründer der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung (RPV) und von 1928 bis 1930 deren letzter Präsident. Sophia Liosner-Kannabich war ebenfalls Mitglied der RPV bis diese 1930 im Zuge der stalinistischen Kulturrevolution aufgelöst wurde. Von 1936 bis 1941 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Moskauer Poliklinik des Zentralen Psychiatrischen Instituts des Volkskommissariats für Gesundheitswesen der RSFSR. Ab 1942 arbeitete sie im Bereich der psychiatrischen Überprüfung von Arbeitsunfähigkeit.
1934 haben Sophia Liosner und Juri Kannabich eine Pseudohalluzination beschrieben, die als Kannabich-Liosner-Symptom [Каннабиха–Лиознера симптом] bekannt wurde. Sie nimmt die Form einer lautlosen Begrüßung durch einen Unbekannten an, der den Patienten mit seinem Kosenamen anspricht, und gilt als Kennzeichen einer beginnenden oder rudimentären Schizophrenie. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN
- Du masque opératoire. Med. Diss. Montpellier 1903
- LITERATUR + LINKS
- Archiv Alexander N. Yakovlev (7.12.2016)
- BillionGraves (6.7.2022)
- Чевычелов, Сергей: Перед покоем (В поисках клиники Стравинского) (Auf der Suche nach der Strawinsky-Klinik). Семь искусств Nr. 9 (66) сентябрь 2015 (10.11.2021)
- Гериш, Анатолий: Интервью с Софьей Лиознер-Каннабих [Interview mit Sophia Liosner-Kannabich] 1967. Transkript und Kommentar von Anna Styrina und Alisa Kuznetsova. Музей «Психиатрическая клиническая больница № 4», 29.9.2023 (13.9.2024)
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002
- Макеева, Марина: Ивана Бездомного могли «лечить» в Покровском-Стрешневе [Iwan Besdomny hätte in Pokrowskoje-Streschnewo "geheilt" werden können]. Москва. Северо-Запад, 04 Окт 2019
- ПКБ Nr. 12 имени Каннабиха [Psychiatrische Klinik J. V. Kannabich] (gelöscht)
- Wikipedia: Sophia Abramowna Liosner; Juri Wladimirowitsch Kannabich (16.9.2024)
- FOTO: Neusosar (1.2.2021)
Sara Neiditsch (1875-1966)
Sara Adolfowna Neiditsch* wurde in eine jüdische Familie in Pinsk geboren, das damals zum Russischen Reich gehörte. Sie war eines von zehn Kindern des Kaufmanns Jehuda-Adolf Neiditsch und seiner Frau Bracha-Bertha Neiditsch. Nach dem Tod ihrer Eltern kümmerte sie sich in Pinsk um ihre jüngste Schwester Olga, bis sie gemeinsam zu ihrem Bruder Isak Neiditsch nach St. Petersburg zogen und später mit ihm nach Moskau. 1901 begann Sara Neiditsch ihr Medizinstudium in Halle, setzte es in Bern und von 1905 bis 1907 in Zürich fort. Hier freundete sie sich mit ihrer Studienkollegin Tatiana Rosenthal an.
1907 kehrte Sara Neiditsch nach Russland zurück, wo sie die frühen Ansätzen der Psychoanalyse erkundete und als erste darüber berichtete. 1910 promovierte sie in Berlin über die Frage der Ansteckung von Krebs. Von Sommer 1909 mindestens bis Winter 1912/13 war sie als Medizinstudentin (vermutlich Postdoktorandin) an der Universität Genf eingeschrieben. Bis 1914 arbeitete sie an der Augenklinik der Universität Genf. Ob sie vor oder nach der Oktoberrevolution in Russland tätig war, ist eher unwahrscheinlich, da ihre Geschwister vor den Bolschewiki fliehen mussten.
Ende 1920 war Sara Neiditsch wieder in Berlin, wo sie in Max Eitingons neu eröffneter Psychoanalytischen Poliklinik Analysen mit Patient:innen durchführte. Als sich 1921 Tatjana Rosenthal in Petrograd das Leben nahm, verfasste Neiditsch einen Nachruf auf ihre Freundin und Kollegin und außerdem einen Bericht über die Lage der Psychoanalyse in Russland nach 1917.
Wahrscheinlich kehrte Sara Neiditsch nicht nach Russland zurück, ihr Name tauchte im Mitgliederverzeichnis der 1922 gegründeten Russischen Psychoanalytischen Vereinigung nicht auf. Stattdessen ging sie nach Paris, wo sich ihr Bruder Isak als Alkohol- und Zuckerfabrikant etabliert hatte. Dort praktizierte sie in den 1920er und 1930er Jahren als Psychoanalytikerin, gehörte jedoch keiner psychoanalytischen Vereinigung an. 1925 nahm sie als "membre adhérent" am 29. Kongress der "Médecins Aliénistes et Neurologistes de France et des Pays de Langue Française" in Paris teil.
Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Frankreich 1940 gelang den meisten der Familie Neiditsch die Flucht in die USA. Sara Neiditsch blieb mit ihrer Schwester Fania in Paris und überlebte die deutsche Besatzungszeit im Versteck. Auch nach Kriegsende lebte sie bis zu ihrem Tod in Paris. (Artikelanfang)
- *Zu den verschiedenen Schreibweisen ihres Namens s. Ginor und Remez 2020
- SCHRIFTEN (Auswahl)
- Zur Frage der Kontagiosität des Krebses. Med. Diss. Berlin 1910
- Über den gegenwärtigen Stand der Freudschen Psychologie in Rußland. Jb psychoanal psychopathol Forsch 2, 1910, 347-348
- Un cas de sarcome mélanique de choroïde. Revue médicale de la Suisse romande 36, 1916, 270ff
- Die Psychoanalyse in Rußland während der letzten Jahre. IZP 7 (3), 1921, 381-384
- Dr. Tatiana Rosenthal, Petersburg. IZP 7 (3), 1921, 384f
- LITERATUR + LINKS
- Eitingon, Max: Bericht über die Berliner Psychoanalytische Poliklinik (März 1920 bis Juni 1922.). IZP 8, 1922, 506-552 [Report of the Berlin Psycho-Analytical Policlinic. Bull Int Psycho-Anal Assn 4, 1923, 254-269]
- Etkind, Alexander: Eros des Unmöglichen. Die Geschichte der Psychoanalyse in Rußland. Leipzig 1996
- Ginor, Isabella, und Gideon Remez: Sara Neiditsch: Neue Informationen über eine schattenhafte Gestalt - und neue Fragen. Luzifer-Amor 33 (66), 2020, 152-155 + Sara Neiditsch: New light on an elusive figure ‒ and new questions (17.9.2025)
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002
- Marti, Jean: La psychanalyse en Russie et en Union soviétique de 1909 à; 1930. Critique 32, 1976, 199-236
- Matrikeledition der Universität Zürich (6.6.2019)
Militsa Netschkina (1901-1985)

Die sowjetische Historikerin Militsa (Miliza) Wassiljewna Netschkina, geboren in Nischyn, Ukraine. Ihr Vater war Ingenieur und Direktor der Berufsschule in Nischyn. 1918 begann sie ihr Studium an der Fakultät für Geschichte und Philologie der Universität Kasan, das sie 1921 abschloss. 1922 gehörte sie wie Rosa Awerbuch zu den ersten Mitgliedern der von Alexander Luria im gleichen Jahr gegründeten Kasaner Psychoanalytischen Vereinigung. Die Kasaner Gruppe führte vermutlich als erste in Russland eine Diskussion über die Vereinbarkeit von Psychoanalyse und Marxismus. 1923 hielt die Netschkina in der Kasaner Vereinigung einen Vortrag über psychoanalytische Mechanismen in Gustav Meyrinks Golem.
1924 zog Militsa Netschkina nach Moskau und unterrichtete politische Ökonmie und Geschichte an der Arbeiterfakultät der Staatlichen Universität Moskau sowie Geschichte der UDSSR an der Kommunistischen Universität der Werktätigen des Ostens. Gleichzeitig war sie von 1924 bis 1927 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Institut der Russischen Assoziation der sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute. 1925 heiratete sie den Chemiker und Pädagogen David Arkadjewitsch Epstein (1898-1985), den sie an der Arbeiterfakultät kennengelernt hatte.
1936 promovierte sie bei Michail Pokrowski an der Staatlichen Universität Moskau über "A. S. Gribojedow und die Dekabristen". Im gleichen Jahr begann ihre langjährige Tätigkeit am Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, wo sie bis 1985 zur russischen Geschichte lehrte und forschte. Ihr mit drei Leninorden und dem Stalinpreis ausgezeichnetes Werk ist vor allem der Geschichte der Dekabristen und der revolutionären Bewegungen im Russland des 19. Jahrhunderts gewidmet. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN + VORTRÄGE (Auswahl)
- S. Freuds „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“. Vortrag, Kasaner Psychoanalytische Vereinigung, 23.11.1922
- Из "деловых дневников" 1922-1923 [Aus den "Arbeitstagebüchern" 1922-1923]. История повседневности (10.6.2025)
- G. Meyrink's „Golem“. Vortrag, Kasaner Psychoanalytische Vereinigung, 5.3.1923
- Общество соединённых славян [Die Gesellschaft der Vereinten Slawen]. Moskau; Leningrad 1927
- История пролетариата СССР [Geschichte des Proletariats der UdSSR]. Moskau 1930-1935
- А. С. Грибоедов и декабристы [A. S. Gribojedow und die Dekabristen] (1936). Moskau 1947
- А. С. Пушкин и декабристы [A. S. Puschkin und die Dekabristen]. Moskau; Leningrad 1938
- Восстание 14 декабря 1825 года [Der Aufstand vom 14. Dezember 1825]. Moskau 1951
- Движение декабристов [Die Dekabristenbewegung]. Bd. 1 und 2. Moskau 1955
- Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества [Wassili Ossipowitsch Kljutschewski. Geschichte seines Lebens und Schaffens]. Moskau 1974
- LITERATUR + LINKS
- Etkind, Alexander: Eros des Unmöglichen. Die Geschichte der Psychoanalyse in Rußland (1993). Leipzig 1996
- The Great Soviet Encyclopedia, Bd. 23. New York 1979 + The Free Dictionary (10.9.2020)
- IZP 8 (4), 1922, 525; IZP 9 (2), 1923, 238; IZP 9 (4), 1923, 544
- Мироненко, С.В., und Е.Л. Рудницкая (Hg.): История в человеке - академик Милица Васильевна Нечкина. [Figuren der Geschichte - die Akademikerin Militsa Wassiljewna Netschkina]. Moskau 2011
- Wikipedia: Militsa Wassiljewna Nechkina; David Arkadjewitsch Epstein (10.9.2020)
- Ученые МПГУ [Wissenschaftler der Staatlichen Pädagogischen Universität Moskau] (6.7.2022)
- Залесский К.А.: Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь [Stalins Reich. Biografisches Lexikon]: Нечкина Милица Васильевна. Моskau 2000 (17.9.2024)
- FOTO: Wikidata (12.6.2025)
Angela Rohr geb. Müllner (1890-1985)

Angela Rohr wurde in Znaim in Österreich-Ungarn als Angela Helene Müllner geboren. Ihr Vater war Eisenbahnschaffner und ein Anhänger des Deutschnationalismus. Sie besuchte das Mädchenlyzeum von Eugenie Schwarzwald in Wien, verließ aber noch vor der Matura die Schule und heiratete Leopold Hubermann (1888-1928), einen polnischen expressionistischen Schriftsteller und Vater ihrer Tochter Ligeia. Nach dem Scheitern ihrer Ehe begann Angela Hubermann 1914 in Paris ein autodidaktisches Studium der Medizin.
Im selben Jahr übersiedelte sie in die Schweiz, um ein Lungenleiden auszukurieren und ihr Medizinstudium fortzusetzen. Sie verkehrte in Zürich in Dadaisten-Kreisen und lernte dort den deutschen Publizisten Simon Guttmann (1891-1990) kennen, mit dem sie 1916 eine zweijährige Scheinehe einging. Seit 1914 erschienen literarische Texte von ihr, die meisten in der expressionistischen Zeitschrift Die Aktion. 1919 freundete sie sich in Locarno mit Rainer Maria Rilke an.
Anfang der 1920er Jahre kam Angela Hubermann nach Berlin und wurde 1921 Kandidatin des neugegründeten Berliner Psychoanalytischen Instituts (BPI). Sie schloss sich dem Kreis um Otto Fenichel an und interessierte sich besonders für die Ethnopsychoanalyse. So referierte sie am BPI z. B. über die Sexualsymbolik in ostafrikanischen Sprachen und den Krankheitsbegriff bei den Primitiven. Der Institutsleiter Karl Abraham hob gegenüber Sigmund Freud ihr außergewöhnliches Verständnis für die Psychoanalyse hervor.
Am BPI lernte sie den Medizin- und Soziologiestudenten Wilhelm Rohr (1899-1942) kennen, Mitglied der KPD und der Berliner Psychoanalytischen Vereinigung. Sie heiratete ihn 1924 und folgte ihm in die Sowjetunion. Beide waren ordentliche Mitglieder der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung (RPV), Wilhelm Rohr von 1924 bis 1930 und Angela Rohr von 1927 bis 1930. Sie war Mitarbeiterin des 1923 gegründeten Staatlichen Instituts für Psychoanalyse in Moskau und referierte über Themen wie Hysterieanalyse und Psychoanalyse und Religion. Nach der Schließung des psychoanalytischen Instituts 1925 und der Auflösung der RPV 1930 arbeitete Angela Rohr hauptsächlich als Journalistin für deutsche und Schweizer Zeitungen, vor allem für die Frankfurter Zeitung.
Als die deutsche Wehrmacht 1941 die Sowjetunion überfiel, wurden Angela und Wilhelm Rohr wie viele andere Ausländer unter falschem Spionageverdacht verhaftet. Wilhelm Rohr starb vermutlich 1942 im Gefängnis von Saratow. Angela Rohr wurde zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt, auf die elf Jahre Verbannung in Sibirien folgten. Während der ganzen Zeit arbeitete sie als Ärztin und konnte so den Gulag überleben. 1957 wurde sie rehabilitiert und kehrte nach Moskau zurück. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN + VORTRÄGE (Auswahl)
- (Hubermann) Sprachliches. Vortrag BPI, 2.6.1921
- (Hubermann) Über den Begriff der Krankheit bei den Primitiven. BPI, 7.3.1922
- (Hubermann) Julien Varendonck: Über das vorbewusste phantasierende Denken (Rezension). IZP 8 (3), 1922, 358-362
- Über eine Hysterieanalyse. Vortrag RPV, 24.2.1926
- (Ror) Der Lehrer [Nachruf auf Louis Lewin]. Frankfurter Zeitung, 24.1.1930
- Psychoanalyse und Religion. Vortrag RPV, 7.3.1930
- Einführung in die Psychoanalyse. Vorlesung für Ärzte und Pädagogen. RPV, 27.3.1930
- (Pseud. Helene Golnipa) Im Angesicht der Todesengel Stalins. Mattersburg-Katzelsdorf 1989
- Der Vogel. Gesammelte Erzählungen und Reportagen. Hg. von Gesine Bey. Berlin 2010
- Lager. Berlin 2015
- Zehn Frauen am Amur. Feuilletons für die Frankfurter Zeitung. Reportagen und Erzählungen aus der Sowjetunion (1928-1936). Berlin 2018
- LITERATUR + LINKS
- Bey, Gesine: Geheimnisse, die »wie große Katzen« durch die Menschen laufen. Die Schriftstellerin und Ärztin Angela Rohr - Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts und der Psychoanalyse. Jb Psychoanal 63, 2011, 157-179
- Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) (20.8.2020)
- Geni (20.8.2020)
- IZP 7 (3), 1921, 390-400; IZP 8 (2), 1922, 238-248; IZP 11 (1), 1925, 131-144; IZP 12 (2), 1926, 219-230; IZP 13 (1), 1927, 128-140; IZP 16 (3-4), 1930, 525-560
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Rußland und Israel. Tübingen 2002
- Marte, Hans: Die Grenzgängerin. Das außergewöhnliche Schicksal der österreichischen Ärztin Dr. Angela Rohr. In E. Busek (Hg.): Der Grenzgänger. Klagenfurt-Wien 2000, 143-153
- Mit Freud in Berlin: Angela Rohr (20.8.2020)
- Schmitter, Elke: Das Nagelbrett der Revolution. Der Spiegel Nr. 25, 2010, 118-121
- Wikipedia (20.8.2020)
- FOTO: Wikipedia; s. a. Scherbensammeln (17.9.2024)
Tatiana Rosenthal (1884-1921)

Tatiana Rosenthal war eine frühe Pionierin der Psychoanalyse in Russland. Sie wurde in Minsk in eine jüdische Familie geboren als ältestes von fünf Kindern des Kaufmanns Chonel Gidelewitsch Rosenthal und Anna Abramowna Schabad. Nach Hospitationen an den Universitäten Halle, Berlin und Freiburg schrieb sie sich 1902 an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich ein. Sie unterbrach ihr Studium, um an der revolutionären Bewegung in Russland teilzunehmen, und engagierte sich im Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund. Ein Bundist der ersten Stunde war der Berufsrevolutionär Michail Markowitsch Rosen, den sie später heiratete und von dem ihr 1915 geborener Sohn Adrian stammte.
Zwischen 1906 und 1908 war Tatiana Rosenthal an der Juristischen Fakultät der Höheren Bestuschewsker Frauenkurse in St. Petersburg immatrikuliert. Inspiriert durch die Lektüre von Sigmund Freud nahm sie jedoch 1907 ihr Medizinstudium in Zürich wieder auf und promovierte 1909 in Gynäkologie. Im gleichen Jahr kehrte sie nach Russland zurück, um ab 1910 als Ärztin in St. Petersburg zu praktizieren. Neben ihrer Privatpraxis war sie drei Jahre lang Assistenzärztin an der von Wladimir Bechterew geleiteten Klinik für Seelen- und Nervenkranke.
Ihre psychoanalytische Ausbildung begann Tatiana Rosenthal vermutlich an der Zürcher Psychiatrischen Klinik Burghölzli und setzte sie bei Karl Abraham in Berlin fort. Sie reiste 1911 und 1912 nach Berlin und Wien und nahm an den Sitzungen der Berliner und der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (BPV und WPV) teil. In ihrem 1911 in der BPV gehaltenen Vortrag über Karin Michaelis' Roman Das gefährliche Alter verwendete sie freudianische und jungianische Begriffe. Ende 1911 wurde sie Mitglied der BPV und der WPV.
Nach der Oktoberrevolution arbeitete Tatiana Rosenthal von 1919 bis 1921 in Petrograd an Bechterews Forschungsinstitut für Gehirnpathologie, wo sie das Ambulatorium und das Labor für Psychotherapie leitete, und als Chefärztin am Pädagogisch-Klinischen Institut, Bechterews psychoneurologischem Institut für Kinder. Sie wurde eine anerkannte Spezialistin für die psychoanalytische Psychotherapie mit Kindern und Erwachsenen und trug durch Kurse und Vorträge über Psychoanalyse zu deren Verbreitung und Professionalisierung in der Sowjetunion bei. Überzeugt von der Vereinbarkeit der Lehren von Marx und Freud, plädierte sie für eine auf psychoanalytischen Grundsätzen basierende Sexualerziehung in der sozialistischen Gesellschaft.
1919 erschien Rosenthals psychogenetische Studie über Dostojewski. Ihre Thesen über Dostojewskis Affektepilepsie, seine ausgeprägte Ambivalenz und die Rolle traumatischer Kindheitserlebnisse griff Sigmund Freud in seiner späteren Abhandlung Dostojewski und die Vatertötung auf, ohne jedoch Rosenthal zu erwähnen. Der zweite Teil ihrer Dostojewski-Studie sowie zwei Aufsätze Über den Angstaffekt der Kriegsneurotiker und Über Adlers Individualpsychologie blieben unveröffentlicht.
1920 wurde Michail Rosen, inzwischen Leiter der staatlichen Verbrauchergenossenschaft, wegen angeblicher Korruption zu 15 Jahren Lagerhaft verurteilt. Angesichts der zunehmenden politischen Repression geriet Tatiana Rosenthal in eine schwere psychische Krise und nahm sich ein Jahr später das Leben. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN + VORTRÄGE
- Über Mastitis puerperalis. Med. Diss. Zürich 1909
- "Opasnij Wostrast" Karin Michaelis w swjete psichoanalisa. Psichotherapija, Nr. 4-5, 1911, 189-194; Nr. 6, 1911, 273-289 [Karin Michaelis: "Das gefährliche Alter" im Lichte der Psychoanalyse. Zentralblatt 1911, 277-294]
- Stradanie i tvortschestwo Dostojewskogo. Psichogenititscheskoe isledowanie [Das Leiden und Schaffen Dostojewskis. Psychogenetische Studie]. Woprosy isutschenija i wospitanija litschnosti Nr. 1, 1919, 88-107
- Über die Sexualerziehung von Kindern. Vortrag auf der 8. Konferenz für Sexualerziehung 1919 in Petrograd
- Die Bedeutung der Freudschen Lehre für die Kindererziehung. Vortrag auf dem ersten Allrussischen Kongress über die Behandlung psychisch behinderter Kinder 1920 in Moskau
- LITERATUR + LINKS
- Accerboni, Anna Maria Pavanello: Tatiana Rosenthal (1885-1921). In E. Federn und G. Wittenberger (Hg.): Aus dem Kreis um Freud. Frankfurt/M. 1992, 103-107
- Accerboni, Anna Maria: Tatiana Rosenthal (1885-1921). Une brève saison analytique. Rev Int Hist Psychanal 5, 1992, 95-111
- Accerboni, Anna Maria: Rosenthal, Tatiana. In Dictionnaire international de la psychanalyse (2002). Hg. von A. de Mijolla. Paris 2005, 1582f [International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit u. a. 2005, 1515-1516]
- Аржанов, Н. П.: Граждане кантона Ури. Провизор Nr. 23, 2003 [Arschanow, N. P.: Bürger des Kantons Uri] (17.9.2024)
- Chronik der DPG (1907-1958) (24.6.2025)
- Etkind, Alexander: Eros des Unmöglichen. Die Geschichte der Psychoanalyse in Rußland. Leipzig 1996
- Freud, Sigmund, und Karl Abraham: Briefwechsel 1907-1925, Bd. 1: 1907-1914. Wien 2009
- Kadis, Leonid R.: Ja moloda, ja shiwu, ja ljubljo...Tragedia Tatiana Rosenthal [Ich bin jung, ich lebe, ich liebe... Die Tragödie der Tatjana Rosenthal]. Ishewski 2018
- Kadis, Leonid: What do we know about Tatiana Rosenthal? An Interview with Leonid Kadis. In K. Naszkowska (Hg.): Early Women Psychoanalysts. London; New York 2024
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Russland und Israel. Tübingen 2002
- Leo, Giuseppe: Auto-emancipazione e psicoanalisi. Il percorso umano di Tatiana Rosenthal. Setting 24, 2007, 99-116
- Marti, Jean: La psychanalyse en Russie et en Union soviétique de 1909 à; 1930. Critique 32 (346), 1976, 199-236
- Matrikeledition der Universität Zürich (6.6.2019)
- Meier Zur, Sabina: Die Rückkehr der Tatjana Rosental ins kulturelle Gedächtnis Russlands. Luzifer-Amor 33 (66), 2020, 156-166
- Meier Zur, Sabina: Psychoanalyse und russischer Symbolismus in Wechselwirkung. Tatjana Rosenthals Gedichte und Dostojewski-Aufsatz. Luzifer-Amor 35 (69), 2022, 136-152
- Miller, Martin Alan: Freud and the Bolsheviks. Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union. New Haven 1998
- Mühlleitner, Elke: Biographisches Lexikon der Psychoanalyse. Tübingen 1992
- Neiditsch, Sara: Die Psychoanalyse in Rußland während der letzten Jahre. IZP 7 (3), 1921, 381-384
- Neiditsch, Sara: Dr. Tatiana Rosenthal, Petersburg. IZP 7 (3), 1921, 384-385
- Neumann, Daniela: Studentinnen aus dem Russischen Reich in der Schweiz (1867-1914). Zürich 1987
- Richebächer, Sabine: Sabina Spielrein. "Eine fast grausame Liebe zur Wissenschaft". Biographie. Zürich 2005
- Roudinesco, Elisabeth, und Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse (1997). Wien, New York 2004
- Wikipedia: deutsch; russisch (17.9.2024)
- Zalambani, Maria, und Leonid Kadis (Hg.): Tatiana Rosenthal. Pioniera della psicoanalisi russa. Pisa 2024
- FOTO: Edizioni ETS
Vera Schmidt geb. Janizkaja (1889-1937)

© ERGO-Verlag, Izhevsk
Vera Fjdorowna Schmidt wurde in Starokostjantyniw in der Ukraine geboren. Ihre Eltern zählten zur russischen Intelligenzia, ihre Mutter Jelisaweta Janizkaja geb. Grosman war eine der ersten Ärztinnen in Russland. Ihr Vater Fjodor Feodosjewitsch Janizki war Bezirksarzt und Epidemiologe sowie Militärarzt. Vera besuchte das Mädchen-Gymnasium in Odessa, wo sie sich 1905 an der revolutionären Bewegung beteiligte.
Vera Janizkaja begann 1908 ein Studium an den Bestuschewsker Höheren Frauenkursen in St. Petersburg, das sie 1912 mit einem Lehrerinnendiplom abschloss. Anschließend studierte sie von 1913 bis 1916 am Kiewer Pädagogischen Fröbel-Institut für Frauen. 1913 heiratete sie den Politiker, Mathematiker und Geophysiker Otto Juljewitsch Schmidt (1891-1956) und zog mit ihm 1917 nach Moskau. Nach der Oktoberrevolution arbeitete Vera Schmidt von 1918 bis 1920 in der Vorschulabteilung des Volkskommissariats für Bildung. In den 1920er Jahren absolvierte sie ein Studium am Institut für höhere Nervenaktivität der Kommunistischen Akademie in Moskau und führte ab 1927 einen Doktortitel.
1921 eröffnete in Moskau das Psychoanalytische Kinderheim-Laboratorium (Detski Dom), das von Vera Schmidt geleitet wurde. In dieser staatlichen Institution wurden ein- bis fünfjährige Kinder nach marxistischen und psychoanalytischen Prinzipien erzogen. Die Eltern waren überwiegend Parteifunktionäre, Stalins Sohn Wassili war dabei, ebenso Schmidts 1920 geborener Sohn Wladimir. Das Kinderheim-Laboratorium erhielt ab 1922 Zuwendungen einer deutschen Bergarbeitervereinigung und wurde in "Internationale Solidarität" umbenannt. Vera Schmidts Eriehungskonzept zielte auf eine Sublimierung ohne Zwang. Der Äußerung von Triebregungen sollte zunächst freier Lauf gelassen werden, ohne Bestrafung oder Verbote. Die Sublimierung geschieht dann durch die positive Bindung des Kindes an die Erzieherin, den korrigierenden Einfluss des Kinderkollektivs sowie durch Erklären und Verstehen.
Vera Schmidts Ideen wurden weit über die Sowjetunion hinaus bekannt, sie inspirierten die Kibbuz-Erziehung in Israel ebenso wie die antiautoritäre Kinderladenbewegung in Deutschland. 1923 reiste sie mit ihrem Mann nach Wien, um Sigmund Freud über ihre Arbeit zu informieren und um Unterstützung zu bitten. Ihr Projekt wurde von Freud und anderen Psychoanalytiker:innen, darunter Annie und Wilhelm Reich, mit Interesse aufgenommen, die Leitung der IPV zeigte sich jedoch ablehnend bis feindselig. Nach internen Konflikten und Gerüchten über angeblich vom Personal ermutigte sexuelle Exzesse unter den Kindern ordnete das Volkskommissariats für Bildung 1925 die Liquidierung des Kinderheim-Laboratoriums an.
Als 1922 die Russische Psychoanalytische Vereinigung (RPV) gegründet wurde, gehörten Vera und Otto Schmidt zu den Gründungsmitgliedern. Vera Schmidt war von 1927 bis 1930 Sekretärin der Vereinigung. Nach Auflösung der RPV 1930 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an Lew Wygotskys Institut für experimentelle Defektologie der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der UdSSR. Wera Schmidt starb im Alter von 48 Jahren an einem Schilddrüsentumor. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN (Auswahl; russische Titel s. Ergo-Verlag)
- Psychoanalytische Erziehung in Sowjetrußland. Bericht über das Kinderheim-Laboratorium in Moskau. Leipzig, Wien, Zürich 1924
- Die Bedeutung des Brustsaugens und Fingerlutschens für die psychische Entwicklung des Kindes. Imago 12 (2/3), 1926, 377-392
- Das psychoanalytische Kinderheim in Moskau. Almanach des Internationalen Psychoanalytischen Verlages 1, 1926, 110-112
- Onanie bei kleinen Kindern. Z psa Päd 2, 1927/28, 153-157
- Die Entwicklung des Wisstriebes bei einem Kind. Imago 16 (2), 1930, 246-289
- Sämtliche Werke. Freiburg 2010
- LITERATUR, LINKS + FILME
- Brenner, Frank: Kühnes Denken: Psychoanalyse in der Sowjetunion. World Socialist Web Site, 7. Juli 1999 (8.7.2025)
- Etkind, Alexander: Eros des Unmöglichen. Die Geschichte der Psychoanalyse in Rußland. Leipzig 1996
- Kloocke, Ruth: Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Russland und Israel. Tübingen 2002
- Kühn, Regine, und Eduard Schreiber: Trotzkis Traum. Psychoanalyse im Lande der Bolschewiki. Dokumentarfilm. Berlin; Moskau 2000
- Manson, Irina: Schmidt, Vera Fedorovna. In Dictionnaire international de la psychanalyse (2002). Hg. von A. de Mijolla. Paris 2005, 1613f [International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit u. a. 2005, 1543-1544]
- Richebächer, Sabine: Psychoanalyse in Russland - Gefährliche Liaison mit der Macht. NZZ, 2.12.2017
- Roudinesco, Elisabeth, und Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse (1997). Wien, New York 2004
- Trefilova, Olga A., und Ivan A. Rozanov: Life and socio-political views of F. F. Yanitsky (1852–1937). History of Medicine 2 (3), 2015, 319-332
- Wikipedia: Vera Schmidt deutsch; englisch; russisch (6.1.2016)
- Wikipedia: Otto Juljewitsch Schmidt (17.8.2017)
- Яницкий, Опег: Дневник Веры Шмидт [Yanitski, Oleg: Vera Schmidts Tagebuch]. Отечественные записки 5 (62), 2014 (17.9.2024)
- FOTO: Publication with the permission of "Vera F. Schmidt Copyright". All rights reserved
Sabina Spielrein (1885-1942)

Sabina Spielrein gilt als Vordenkerin vieler, später als grundlegend erkannten Konzepte der Psychoanalyse. Sie wurde als ältestes von fünf Kindern in Rostow am Don geboren. Ihr Vater Nikolai Arkadjewitsch Spielrein war ein wohlhabender jüdischer Kaufmann, ihre Mutter Eva Markowna Ljublinskaja hatte Zahnmedizin studiert, übte diesen Beruf aber nicht aus. Sabina Spielrein besuchte bis 1904 das Mädchengymnasium in Rostow. Während ihrer Schulzeit wurden bei ihr Symptome einer "psychotischen Hysterie" diagnostiziert, so dass ihre Eltern sie 1904 nach Zürich in die psychiatrische Klinik Burghölzli schickten. Sie wurde dort von Carl Gustav Jung behandelt und 1905 als geheilt aus der Klinik entlassen.
Im selben Jahr nahm sie ein Medizinstudium an der Universität Zürich auf, ihre Analyse setzte sie privat bei C.G. Jung fort. Aus der therapeutischen entwickelte sich eine Liebesbeziehung, die Gegenstand eines berühmten Briefwechsels zwischen C.G. Jung und Sigmund Freud wurde. 1909 erklärte der mit Emma Jung verheiratete Jung die Beziehung für beendet. Unter seiner Anleitung promovierte Spielrein 1911 Über den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie, es war die erste psychoanalytisch orientierte Dissertation einer Frau. Anschließend reiste sie nach Wien, wo sie mit Freud zusammentraf und im Oktober 1911 Mitglied der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (WPV) wurde.
1912 erschien Sabina Spielreins wichtigste theoretische Schrift Die Destruktion als Ursache des Werdens. Darin untersuchte sie die Funktion des Todesinstinkts als destruktive Komponente des Sexualinstinkts und nahm Überlegungen zum Todestrieb vorweg, auf die sich später Freud in Jenseits des Lustprinzips bezog. Analog zur biologischen Zeugung, so ihre These, bei der in der Vereinigung der männlichen mit der weiblichen Zelle jede in ihrer Einheit vernichtet wird, damit neues Leben entsteht, sei der Fortpflanzungstrieb auch psychologisch ein Werde- und Zerstörungstrieb: Die von Abwehrgefühlen begleitete Destruktion des Indiviudal-Ichs bildet die Voraussetzung der mit Lustgefühlen verbundenen Kreation.
Sabina Spielrein heiratete 1912 den russisch-jüdischen Arzt Pawel Naumowitsch Scheftel (1881-1937), ein Jahr später wurde ihre Tochter Renata geboren. Von 1912 bis 1914 lebte sie mit ihrer Familie in Berlin und veröffentlichte mehrere psychoanalytische Aufsätze zur Kinder- und Traumanalyse. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs zog sie in die Schweiz, während ihr Mann nach Russland zurückkehrte. Ab 1915 lebte Sabina Spielrein in Lausanne und gründete dort 1919 die psychoanalytische Studiengruppe Cercle Interne. 1921 übersiedelte sie nach Genf und wurde Mitglied der von Edouard Claparède geführten Genfer Psychoanalytischen Gesellschaft. Sie hielt Vorlesungen am Institut Jean-Jacques Rousseau und publizierte zahlreiche Arbeiten, darunter kinderanalytische Mitteilungen aus der Kinderzeit ihrer Tochter. 1922 trat sie von der WPV in die Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse über. Ihr berühmtester Analysand in dieser Zeit war Jean Piaget.
In ihrer Genfer Zeit entwickelte sie einen linguistisch fundierten Ansatz der Psychoanalyse mit dem Schwerpunkt auf der Sprachentwicklung im frühen Kindesalter und dem Zusammenhang von Sprechen und Denken beim Kind. Sie unterschied eine autistische, eine magische und eine soziale Phase der Sprachentwicklung bei Säuglingen und Kleinkindern und verwies auf die Analogie zwischen dem Denken von Kindern, der Aphasie und dem unbewusstem Denken.
1923 kehrte Sabina Spielrein mit ihrer Tochter in das inzwischen sowjetische Russland zurück. Sie ließ sich in Moskau nieder und wurde Mitglied und Lehranalytikerin der ein Jahr zuvor gegründeten Russischen Psychoanalytischen Vereinigung (RPV). Sie hielt am Staatlichen Institut für Psychoanalyse Vorlesungen und Seminare über Kinderanalyse und arbeitete als Ärztin am Ambulatorium. Außerdem war sie Leiterin der Abteilung Kinderpsychologie an der Moskauer Universität und Mitarbeiterin in Vera Schmidts Kinderheim-Laboratorium.
1924 zog Sabina Spielrein wieder in ihre Heimatstadt Rostow zu ihrem Mann Pavel Scheftel und bekam 1926 ihre zweite Tochter Eva. Sie arbeitete als Pädologin am Rostower prophylaktischen Schulambulatorium und behandelte Kinder und Erwachsene in der psychiatrischen Poliklinik. Trotz des Verbots von Pädologie und Psychoanalyse 1936 setzte sie ihre psychoanalytische Tätigkeit vermutlich bis Anfang der 1940er Jahre fort.
Im Juli 1942 besetzte die Deutsche Wehrmacht Rostow am Don. Sabina Spielrein und ihre beiden Töchter wurden im August 1942 zusammen mit 20.000 anderen Rostower Juden von einem Kommando der Einsatzgruppe D umgebracht. (Artikelanfang)
- SCHRIFTEN (Auswahl; ausführlich s. International Association for Spielrein Studies)
- Über den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie (Dementia Praecox). Jb psychoanal psychopathol Forsch 3 (1), 1911, 329-400
- Die Destruktion als Ursache des Werdens. Jb psychoanal psychopathol Forsch 4, 1912, 465-503
- Zwei Mensesträume. IZP 2, 1914, 32-34
- Tiersymbolik und Phobie bei einem Knaben. IZP 2, 1914, 375f
- Der vergessene Name. IZP 2, 1914, 383
- Ein unbewußter Richterspruch. IZP 3, 1915, 350f
- Die Äußerungen des Ödipuskomplexes im Kindesalter. IZP 4, 1917, 44-47
- Renatchens Menschenentstehungstheorie. IZP 6 (2), 1920, 155f
- Das Schamgefühl bei Kindern. IZP 6 (2), 1920, 157f
- Das schwache Weib. IZP 6 (2), 1920, 158
- Verdrängte Munderotik. IZP 6 (4), 1920, 361
- Schnellanalyse einer kindlichen Phobie. IZP 7 (4), 1921, 473f
- Die Entstehung der kindlichen Worte Papa und Mama. Einige Betrachtungen über verschiedene Stadien in der Sprachentwicklung. Imago 8 (3), 1922, 345-367
- Ein Zuschauertypus. IZP 9(2), 1923, 210f
- Quelques analogies entre la pensée de l'enfant, celle de l'aphasique et la pensée subconsciente. Archives de Psychologie 18, 1923, 306-322 [Some analogies between thinking in children, aphasia and the subconscious mind. In P. Cooper-White and F. Kelcourse (eds): Sabina Spielrein and the Beginning of Psychoanalysis. Abingdon, Oxon, 2019, 301–322]
- L'automobile: symbole de la puissance mâle. IJP 4, 1923, 128
- Rève et vision des étoiles filantes. IJP 4, 1923, 129ff
- Die Zeit im unterschwelligen Seelenleben. Imago 9 (3), 1923, 300-317
- Quelques analogies entre la pensée de l'enfant, celle de l'aphasique et la pensée subconsciente. Archives de Psychologie 18, 1923, 306-322
- Kinderzeichnungen bei offenen und geschlossenen Augen. Imago 17 (3), 1931, 359-391
- Ausgewählte Schriften. Berlin 1986
- Destruction as a cause of coming into being. Journal of Analytical Psychology 39, 1994, 155-186
- Sämtliche Schriften. Gießen 2002
- Tagebuch und Briefe. Die Frau zwischen Jung und Freud. Hg. von T. Hensch. Gießen 2003
- Nimm meine Seele. Tagebücher und Schriften. Hg. von T. Hensch. Berlin 2006
- The Essential Writings of Sabina Spielrein. Pioneer of Psychoanalysis. Hg. von R. I. Cape und R. Burt. Milton 2018
- The Untold Story of Sabina Spielrein: Healed & Haunted by Love. Unpublished Russian Diary and Letters. Hg. und übers. von Zvi Lothane. New York 2023
- LITERATUR, LINKS + FILME
- Allain-Dupré, Brigitte: Sabina Spielrein. A bibliography. J Anal Psychol 49 (3), 2004, 421-433
- Alnaes, Karsten: Sabina. Sabina Spielrein - der Roman ihres Lebens. Hamburg 1996
- Appignanesi, Lisa, und John Forrester: Die Frauen Sigmund Freuds. München 1996
- Balsam, Rosemary H.: Women of the Wednesday Society. The presentations of Drs. Hilferding, Spielrein, and Hug-Hellmuth. Am Imago 60 (3), 2003, 303-342
- Carotenuto, Aldo (Hg.): Tagebuch einer heimlichen Symmetrie. Sabina Spielrein zwischen Jung und Freud. Freiburg 1986
- Chambrier, Josianne: Un classique méconnu: Sabina Spielrein (1912), La destruction comme cause du devenir. RFP 66, 2002, 1284-1317
- Deutsche Biographie (23.2.2015)
- Etkind, Alexander: Eros des Unmöglichen. Die Geschichte der Psychoanalyse in Rußland. Leipzig 1996
- Faluvégi, Katallin: Sabina Spielrein and her definition of language (1911–1931). American Imago 81 (4), 2024, 547-569
- Höfer, Renate: Die Psychoanalytikerin Sabina Spielrein (1). Rüsselsheim 2000
- International Association for Spielrein Studies (19.5.2021)
- Karger, André, und Christoph Weismüller (Hg.): Ich hieß Sabina Spielrein. Von einer, die auszog, Heilung zu suchen. Göttingen 2006
- Kerr, John: Eine höchst gefährliche Methode. Freud, Jung und Sabina Spielrein. München 1994
- Kress-Rosen, Nicole: Spielrein, Sabina. In Dictionnaire international de la psychanalyse (2002). Hg. von A. de Mijolla. Paris 2005, 1705f [International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit u. a. 2005, 1639-1640]
- Kühn, Regine, und Eduard Schreiber: Trotzkis Traum. Psychoanalyse im Lande der Bolschewiki. Dokumentarfilm. Berlin; Moskau 2000
- Lothane, Zvi:Tender love and transference. Unpublished letters of C.G. Jung and Sabina Spielrein. IJP 80, 1999, 1189-1204
- Márton, Elisabeth: Ich hieß Sabina Spielrein. Dokumentarfilm. Schweden 2002 (19.9.2024)
- Martynkewicz, Wolfgang: Sabina Spielrein und Carl Gustav Jung. Eine Fallgeschichte. Berlin 1999
- Mühlleitner, Elke: Biographisches Lexikon der Psychoanalyse. Tübingen 1992
- Plastow, Michael Gerard: Sabina Spielrein and the Poetry of Psychoanalysis. Writing and the End of Analysis. Abingdon; New York 2019 [Sabina Spielrein, poésie et vérité. L'écriture et la fin de l'analyse. Toulouse 2021]
- Richebächer, Sabine: Sabina Spielrein - eine Pionierin von Psychoanalyse und Kinderanalyse. Psyche 63, 2009, 589-613
- Richebächer, Sabine: Sabina Spielrein. "Eine fast grausame Liebe zur Wissenschaft". Biographie. Zürich 2005
- Richebächer, Sabine: "Ich sehne mich danach, mit Ihnen allen zusammenzukommen...". Ein Brief von Sabina Spielrein-Scheftel (Rostow am Don) an Max Eitingon vom 24.8.1927. Luzifer-Amor 21 (42), 2008, 65-74
- Roudinesco, Elisabeth, und Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse (1997). Wien, New York 2004
- Skea, Brian R.: Sabina Spielrein. Out from the shadow of Jung and Freud. J Anal Psychol 51, 2006, 527-552
- Stephan, Inge: "Tauschobjekt" zwischen Jung und Freud. Sabina Spielrein (1885-1942). In dies.: Die Gründerinnen der Psychoanalyse. Stuttgart 1992, 83-104
- Stephan, Inge: Die Bedeutung von jüdischen Frauen in der Entwicklungsgeschichte der Psychoanalyse. Das Beispiel Sabina Spielrein mit einem Ausblick auf den Roman "Die russische Patientin" (2006) von Bärbel Reetz. In C.-P. Heidel (Hg.): Jüdinnen und Psyche. Frankfurt/M. 2016, 13-28
- Volkmann-Raue, Sibylle: Sabina Spielrein: Die Destruktion als Ursache des Werdens. In dies. und H. E. Lück (Hg.): Bedeutende Psychologinnen. Weinheim 2002, 60-79
- Wikipedia deutsch, englisch (14.7.2025)
- Wunderlich, Dieter: Sabina Spielrein. Webseite Dieter Wunderlich (11.5.2012)
- FOTO: Mit freundlicher Genehmigung von Elisabeth Márton; weitere Fotos: International Association for Spielrein Studies (19.5.2021)